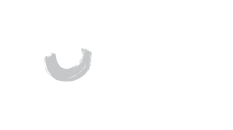Es ist wieder soweit: unser Newsletter ist erschienen! Zu finden sind neben aktuellen Ferienangeboten auch einige Worte zur Rettung unseres Projektes „Lernort Preußenstadion“…
Kategorie: Presse
Stellungnahme von Wissenschaftler:innen zu den Strafbefehlen gegen die Kolleg:innen vom FP Karlsruhe
Hier dokumentieren wir die Pressemitteilung einiger hochrangiger Wissenschaftler:innen zum „Fall Karlsruhe“. Was war dort passiert? In aller Kürze: Die Kolleg:innen in Karlsruhe sprachen nach einem Vorfall des Zündens von Pyrotechnik mit einigen Ultras. Dies nahm die Polizei Karlsruhe zum Anlass, die Kolleg:innen als Zeug:innen vorzuladen, um an die Personalien der vermeintlichen „Täter“ zu gelangen. Die Kolleg:innen lehnten es jedoch ab, der Vorladung nachzukommen und Aussagen vor der Polizei zu machen. Daraufhin lud die Staatsanwaltschaft Karlsruhe die Kolleg:innen vor, was die Kolleg:innen ebenfalls ablehnten. Ihnen wurde zunächst Beugehaft angedroht, zuletzt erhielten sie Strafbefehle.
Das Vorgehen von Polizei und Justiz wird nach mehreren Stellungnahmen des Fanprojekt-Trägers in Karlsruhe und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte nun auch von Seiten der Wissenschaft kritisiert und abgelehnt:
Eine massive Gefährdung der Arbeitsgrundlage Sozialer Arbeit
Presserklärung zu den Strafbefehlen gegen Mitarbeiter:innen des sozialpädagogischen Fanprojekts Karlsruhe
Die Strafbefehle, die kürzlich durch das Amtsgericht Karlsruhe gegen Mitarbeiter:innen des Fanprojekts Karlsruhe erlassen wurden, stellen eine gravierende Gefährdung der Arbeitsgrundlage Sozialer Arbeit dar. Sie sind deshalb über den konkreten Fall hinaus von bundesweiter Bedeutung. Aus wissenschaftlicher Sicht sind sie abzulehnen, auch weil dadurch Möglichkeiten sozialpädagogischer Prävention und Intervention grundsätzlich infrage gestellt werden. Wir fordern die Staatsanwaltschaften und die Gerichte auf, im weiteren Verlauf des Verfahrens die fachwissenschaftlichen Argumente zur Kenntnis zu nehmen und zu würdigen.
Soziale Arbeit ist in unterschiedlichen Arbeitsfeldern damit beauftragt, riskante, fremd- und selbstschädigende Verhaltensweisen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu verhindern. Dies gilt für die Arbeit mit Fußballfans in Fanprojekten ebenso wie unter anderem auch für die mobile Jugendarbeit, für die offene Jugendarbeit sowie für die sozialpädagogische Arbeit mit Wohnungslosen und Drogenabhängigen und schließlich für die Opferberatung oder für Aussteigerprogramme.
Die unverzichtbare Grundlage dieser Arbeit sind vertrauensbasierte Beziehungen zwischen Sozialarbeitenden und ihren Klient:innen. Denn Soziale Arbeit erfordert einen Rahmen, der offene Kommunikation ermöglicht, in der auch Problematisches angesprochen werden kann, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Nur so ist eine fachliche Begleitung und Beratung möglich, in der problematische Verhaltensweisen mit Aufsicht auf Erfolg hinterfragt und Alternativen dazu entwickelt werden können.
Deshalb gilt für die Soziale Arbeit das fachlich Erfordernis eines besonderen Schutzes des Vertrauensverhältnisses. Obwohl dieses bislang nicht durch ein Zeugnisverweigerungsrecht abgesichert ist, wird in der Praxis von den Strafverfolgungsbehörden gewöhnlich anerkannt, dass es sich um ein faktisches Erfordernis handelt. Deshalb wird in der Regel auch darauf verzichtet, Sozialarbeitende im Rahmen der Strafverfolgung als Informationsquelle zu beanspruchen, sofern es nicht um den faktisch seltenen Fall geht, dass Sozialarbeiter:innen im Vorfeld von der Planung gravierender Straftaten erfahren und diese nur durch Informationsweitergabe verhindern können. Für die strafrechtliche Sanktionierung von Bagatelldelikten ist die Soziale Arbeit dagegen ebensowenig zuständig wie die Mitwirkung bei der nachträglichen Aufklärung von Straftaten Bestandteil ihres Mandats ist. Klare Abgrenzungen von Sozialer Arbeit und Strafverfolgung sind nach beiden Seiten hin unverzichtbar.

Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden erkennen gewöhnlich an, dass sozialarbeiterische und sozialpädagogische Angebote einen wichtigen Beitrag zur Bearbeitung sozialer Konflikte und auch zur Vermeidung von Straftaten leisten können. Sie haben deshalb sinnvollerweise kein Interesse daran, die Grundlagen sozialarbeiterischer Intervention und Prävention zu destruieren.
Der nunmehr durch das Amtsgericht Karlsruhe der erlassene Strafbefehl stellt – auch aufgrund seiner Höhe von 120 Tagessätzen – ein deutliches Signal dafür dar, dass all dies infrage gestellt werden soll. Eine entsprechende Verurteilung der Sozialarbeiter:innen des Fanprojekts würde dazu führen, dass ein Vertrauensverhältnis, das die unverzichtbare Arbeitsgrundlage der Sozialen Arbeit in Fanprojekten und anderen Arbeitsfeldern ist, durch die Soziale Arbeit nicht mehr garantiert werden kann. Denn Sozialarbeiter:innen müssten mit gravierenden rechtlichen Zwangsmaßnahmen rechnen, durch die Aussagen erzwungen werden sollen. Eine solche Infragestellung der Arbeitsgrundlage Sozialer Arbeit ist aus fachwissenschaftlicher Sicht entschieden abzulehnen.
Erstunterzeichner:innen:
Prof. Dr. Albert Scherr, Freiburg; Prof. Dr. Holger Ziegler, Bielefeld; Prof. Dr. Roland Roth, Berlin; Prof. Dr. Martina Richter, Duisburg; Prof. Dr. Franz Hamburger, Mainz; Prof. Dr. Verena Klomann, Darmstadt; Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker, Hamburg; Dr. Fabian Fritz, Siegen; Prof. Dr. Bernd Dollinger, Siegen; Prof. Dr. Werner Thole, Dortmund
Skifreizeit der Fanprojekte NRW in Österreich
Hier dokumentieren wir den Bericht unserer Landesarbeitsgemeinschaft der NRW-Fanprojekte:
Die Landesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte NRW hat im Februar erneut eine Skifreizeit in die Wildschönau/Tirol veranstaltet, die nicht nur den Spaß am Wintersport förderte, sondern auch tiefergehende Ziele der Jugendarbeit verfolgte. Mit insgesamt 34 Teilnehmer*innen aus den sozialpädagogischen Fanprojekten in Bielefeld, Bochum, Dortmund, Köln, Münster, Paderborn und Wuppertal bot diese Freizeit eine ideale Plattform für gemeinsame Aktivitäten im Schnee, Reflexion und Austausch. Untergebracht war die gesamte Gruppe auf einem für Jugendgruppen umgebauten Bauernhof, fernab des urbanen Lebens.

Die Ziele dieser Jugendfreizeit waren breit gefächert und spiegelten die vielfältigen Aspekte der Jugendarbeit wider. Neben dem gemeinsamen Skifahren und Snowboarden, das sowohl sportliche Herausforderung als auch Teamgeist förderte, standen auch soziale Interaktionen wie gemeinsames Kochen und gemütliche Abende im Mittelpunkt. Durch ein Kneipenquiz zu Fußball und Fanrelevanten Themen wurde nicht nur der Spaßfaktor erhöht, sondern auch die Möglichkeit geschaffen, über gemeinsame Interessen ins Gespräch zu kommen und sich besser kennenzulernen.

Ein besonderer Schwerpunkt lag zudem auf der Vernetzung der Teilnehmer*innen untereinander sowie mit den Fachkräften. Diese Freizeit bot die Gelegenheit, Beziehungen zu stärken und neue Kontakte zu knüpfen. Durch gemeinsame Erlebnisse konnten Vorurteile abgebaut und ein respektvoller Umgang miteinander gefördert werden. Insbesondere die persönlichen Begegnungen abseits des Alltags ermöglichten einen authentischen Austausch und trugen dazu bei, Verständnis füreinander zu entwickeln.
Insgesamt war die Skifreizeit in der Wildschönau ein voller Erfolg und hat einmal mehr gezeigt, welch wichtige Rolle Jugendarbeit bei der Förderung von Teamgeist, sozialer Kompetenz und interkultureller Verständigung spielen kann. Die Landesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte NRW freut sich, den angeschlossenen Standorten sowie den zahlreichen Teilnehmer*innen solche Möglichkeiten zur Begegnung und zum Austausch zu schaffen und wird sich auch in Zukunft für die nachhaltige und lebensweltorientierte Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen Fußballfans engagieren.
FANport-Newsletter #51
Es ist wieder soweit: unser Newsletter ist erschienen! Zu finden sind neben aktuellen Angeboten auch einige wenige Worte zur Einlasssituation beim Bielefeld-Derby sowie zahlreiche Links und Lesetipps zu unseren dauerhaften Angeboten, vor allem zu unserem Projekt Lernort Preußenstadion.
„!Nie wieder“ – Vortrag zu aktueller rechter Gewalt

Am Donnerstag, den 25. Januar 2024, laden wir um 19:00 Uhr zu einem Vortrag zum Thema „Kein Vergessen – Todesopfer rechter Gewalt nach 1945“ ins neben*an (Warendorfer Straße 45, Münster). Die Veranstaltung ist der diesjährige Beitrag unseres Fanprojektes und unseres Projektes Lernort Preußenstadion zur Kampagne „!Nie Wieder – Erinnerungstag im deutschen Fußball“, die jedes Jahr um den 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee (1945) – und zugleich Internationaler Holocaust-Gedenktag, stattfindet.
Als Referent ist der Buchautor Thomas Billstein eingeladen, der einleitend erklärt, was genau rechte Gewalt ist und wie sie sich von anderen Gewaltverbrechen abgrenzen lässt. Tatmotive wie Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus oder auch Sozialdarwinismus werden erläutert und Statistiken zu Gewaltverbrechen aufgeführt. Besonders die gegenwärtig wahrzunehmende rechte Gewalt wird Gegenstand seines Vortrags sein.

„Mit der Einbettung der Veranstaltung in die Kampagne ‚!Nie Wieder‘ möchten wir einerseits an Verbrechen des historischen Nationalsozialismus erinnern, aber auch auf die Gefahren ganz aktueller rechtsradikaler Bewegungen und Organisationen hinweisen“ so FANport-Leiter Edo Schmidt, der die Veranstaltung organisiert. „Heute müssen wir uns wieder Sorgen um die demokratische Verfasstheit unseres Landes machen, denn Faschismus und rechte Gewalt bestimmen heute wieder die Schlagzeilen“, so der 58-jährige Soziologe. Der Autor Thomas Billstein ist nicht erst seit seiner Buchveröffentlichung im Unrast Verlag 2020 ein ausgewiesener Kenner der rechten und neurechten Szene. Er wird auch über die Hintergründe aktueller Gewalttaten der Rechtsradikalen in Deutschland berichten. Der Eintritt zu seinem Vortrag ist frei.
Zeugnisverweigerungsrecht für die Soziale Arbeit!
OHNE VERTRAUEN GEHT ES NICHT!
AUSSAGEVERWEIGERUNG FÜR DIE SOZIALE ARBEIT MÖGLICH MACHEN!
BÜNDNIS FÜR EIN ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHT IN DER SOZIALEN ARBEIT
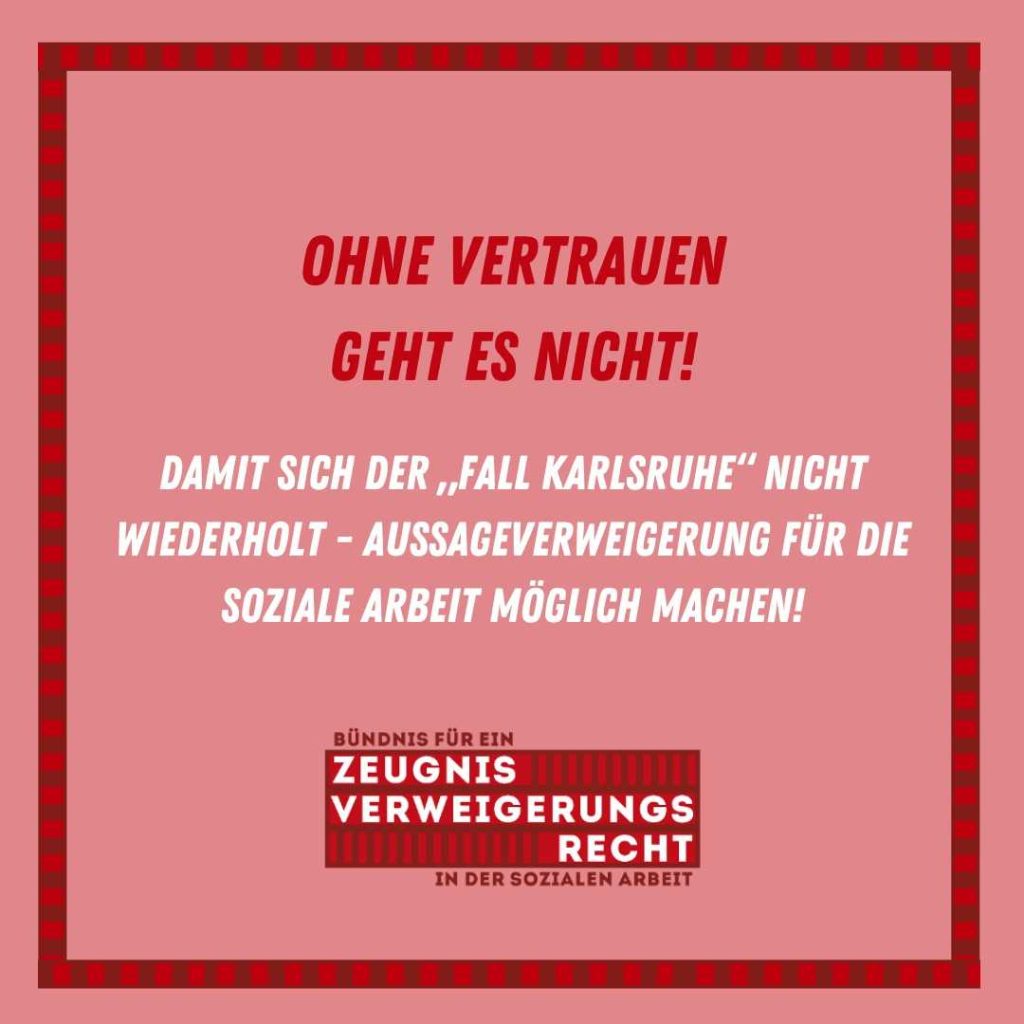
Worum geht es?
Sozialarbeiter:innen in ganz Deutschland gehen einer öffentlich geförderten Tätigkeit nach. Sie arbeiten mit allen Menschen, die sich ihnen mit ihren Sorgen und Problemen anvertrauen. Eine solche Arbeit ist nur möglich wenn die Menschen wissen, dass sie sich hier in einem geschützten Raum bewegen. Sie öffnen sich den Sozialarbeiter:innen ganz so, wie es Menschen auch beispielsweise gegenüber Ärzt:innen, Geistlichen oder Anwält:innen in persönlich schwierigen Lagen tun.
Im Fall Karlsruhe hat die Staatsanwaltschaft die Sozialarbeiter:innen des Fanprojekts vorgeladen und versucht sie dazu zu bewegen, im Rahmen ihrer Arbeit vertraulich erworbenes Wissen preiszugeben. Hätten sie dies getan, hätten sie ihre Arbeit damit ad absurdum geführt. Sie verweigerten also die Aussage – woraufhin die Staatsanwaltschaft erst Ordnungsgelder beantragte und schließlich auch Beugehaft in den Raum stellte. Den Sozialarbeiter:innen drohte also Gefängnis dafür, dass sie ihrem Arbeitsethos treu geblieben sind.
Das muss man doch ändern können?
Richtig, die Bundespolitik muss jetzt reagieren. Sozialarbeiter:innen brauchen für ihre sensible Arbeit mit Menschen die Möglichkeit, die Aussage verweigern zu können („Zeugnisverweigerungsrecht“). Sie dürfen niemals mehr zwischen ihrer Arbeit und persönlichen Konsequenzen bis hin zur Beugehaft wählen müssen. Und auch ihre Zielgruppen müssen wissen, dass sie der Sozialen Arbeit vertrauen können. Der „Fall Karlsruhe“ hat dramatisch gezeigt, dass es an der Zeit ist, zu handeln – daher gilt jetzt mehr denn je: Aussageverweigerung für die Soziale Arbeit möglich machen – denn ohne Vertrauen geht es nicht!
„Jüdischer Sport und Nationalsozialismus in Münster“: FANport Münster relauncht Bildungsprojekt „Spurensuche“
Das bereits im Jahr 2021 vom FANport Münster und „Lernort Preußenstadion“ konzipierte Bildungsprojekt „Spurensuche“ geht mit ein paar inhaltlichen Überarbeitungen in die zweite Runde. Doch worum geht es bei dem Projekt, wie ist es entstanden und was sind die Ziele?
Erinnerungsarbeit durch „Spurensuche“
Das Projekt „Spurensuche“ ist ein erlebnispädagogisches Projekt und beschäftigt sich mit dem Thema „Jüdischer Sport und Nationalsozialismus in Münster“. „Mithilfe der App ‚Biparcours‘ können Schulklassen, Jugendeinrichtungen, Sportvereine, Fanprojekte und weitere Institutionen aus verschiedenen historischen Rundgängen wählen und diese im Zentrum Münsters durchlaufen“, erklärt Jan Becker, Koordinator des „Lernort Preußenstadion“ und ergänzt: „Ausgerüstet mit projekteigenen Tablets können Jugendliche ab 13 Jahren auf eine Art ‚audiogestützte Schnitzeljagd‘ gehen, stets erlebnisorientiert, in einfacher Sprache verfasst und mit dem Ziel über das Thema zu informieren und zu sensibilisieren.“

Aus insgesamt vier verschiedenen Rundgängen à ca. 14 Stationen können die Teilnehmer:innen wählen: „Sport im Nationalsozialismus“, „der jüdische Sportverein ‚Schild‘“, „Ernst Rappoport“ sowie „DJK – Zwei entgegengesetzte Wege“. Mithilfe der Verwendung digitaler Tools wie Fotos, Videos, Sprachaufnahmen oder Zeichnungen, bearbeiten die Jugendlichen auf ihrem Rundgang verschiedene Aufgaben und Rätsel. Somit bietet das Projekt eine abwechslungsreiche und moderne Heranführung an das Thema und trägt maßgeblich zur Erinnerungsarbeit bei.
„Das Projekt bietet einen wichtigen Lernauftrag im Bereich Schule und Jugendbildung“, betont FANport-Leiter Edo Schmidt und ergänzt: „Angesichts aktueller Entwicklungen bietet unser Bildungsprojekt eine von Fachkräften begleitete Möglichkeit, sich dem Thema Antisemitismus anzunähern. Die Schüler:innen und Jugendlichen, für die die ‚Spurensuche‘ gedacht ist, erhalten einen Einblick in jüdisches Leben und speziell in den jüdischen Sport der 1930er Jahre in Münster. Dabei wird auch der Holocaust thematisch behandelt und jugendgerecht aufgearbeitet. Unser Projekt soll dabei helfen, junge Menschen hierüber ins Gespräch und hoffentlich auch ins Nachdenken zu bringen.“
Historischen Orten in Münster begegnen
Die Idee zum Bildungsprojekt entstand während der Corona-Pandemie. Die Initiator:innen stürzten sich in die Recherchearbeit und beschäftigten sich intensiv mit Biografien bekannter jüdischer Sportler:innen und Sportvereine. Außerdem wurden historische Bücher gewälzt, um eine thematische Grundlage zu erarbeiten. Schnell stand fest, dass auch Münsteraner Geschichtsorte, wie beispielsweise die „Villa ten Hompel“, eine wesentliche Rolle bei der Erstellung der Rundgänge spielen werden. Also musste eine Netzwerkkarte her. Die Initiator:innen behielten recht, denn wie sich herausstellte, begegneten einige „Spurensuche“-Teilnehmer:innen vielen historischen Orten zum allerersten Mal. „Viele Kinder lernen die Stadt Münster neu kennen und wissen plötzlich, wo sich das Rathaus befindet oder die Synagoge steht. Daran merken wir, dass diese Form der Aufklärungsarbeit sehr wichtig ist“, erklärt Leo Heider vom „Lernort Preußenstadion“.
Von Mitarbeiter:innen des FANport Münster wird das Bildungsangebot die gesamte Zeit begleitet und nachbereitet. Im Anschluss an den Rundgang haben alle Teilnehmer:innen die Möglichkeit, das Erlebte zu besprechen und Informationen zusammenzutragen. „Oftmals ergeben sich im Nachgang noch Fragen, auf die wir eingehen können. Es ist einfach wichtig, die Jugendlichen mit ihren gesammelten Eindrücken nicht allein zu lassen“, resümiert David Grevelhörster vom FANport Münster.
Das Bildungsprojekt „Spurensuche“ wird durch die Stadt Münster und den Lernort Stadion e.V. gefördert und befindet sich in Trägerschaft der Outlaw Kinder- und Jugendhilfe gGmbH. Anfragen können an den Lernort Preußenstadion gestellt werden, Fragen beantwortet Jan Becker unter 01512 7253946.
„Kollektivstrafe?“ – Nachspiel zum Heimspiel gegen 1860 München
Am Sonntag, den 15. Oktober 2023 spielte der SC Preußen Münster gegen den TSV 1860 München. Zu diesem Spiel gab es für einige M’60-Fans Aufenthaltsverbote der Polizei sowie Hausverbote durch den SCP, die am Spieltag unmittelbar vor dem Spiel ausgesprochen wurden. Dies geschah als Reaktion auf das Aufbringen von Tags und Aufklebern auf Verkehrsschildern bei einem Zwischenstopp der M’60-Fans im Münsterland. Im Folgenden dokumentieren wir hier zwei Artikel, die die Positionen zu diesem Geschehen wiedergeben:
Münster: Unverhältnismäßige Maßnahmen verhindern Stadionbesuch von Löwen-Fans.
Quelle: https://www.tsv1860.de/de/Aktuelles_News/7547.htm
Beim vergangenen Auswärtsspiel des TSV 1860 München beim SC Preußen Münster blieb die aktive Fanszene der Löwen dem Gästeblock fern. Grund war eine unverhältnismäßige Kollektivstrafe, die seitens des Gastgebers gegen einen Teil der Fanszene ausgesprochen wurde. Dies führte dazu, dass sich auch weitere Teile der aktiven Fanszene solidarisierten und den Rückweg nach München ohne Stadionbesuch frühzeitig antraten.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand des TSV 1860 München, der sich aus mehreren Gesprächen mit den betroffenen Gruppierungen, dem SC Preußen Münster, der Autobahnpolizei Dortmund und der Polizei Münster ergibt, wurden auf der Anreise der Löwenfans im Bereich der Autobahnpolizei Dortmund kleinere Sachbeschädigungen von wenigen Mitgliedern einer Fangruppierung des TSV 1860 München festgestellt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde diese Information an den SC Preußen Münster übermittelt. Die Gastgeber entschieden ohne die normal übliche Rücksprache mit dem TSV 1860 München, dass die gesamte Fangruppe für den Spieltag ein Hausverbot für das Preußenstadion erhält und somit trotz des Besitzes einer gültigen Eintrittskarte kein Zutrittsrecht zum Stadion erhält.
Die Löwen-Fans setzten nach Rücksprache mit der Autobahnpolizei Dortmund vorerst die Anreise nach Münster fort. Dort wurden sie von der Polizei Münster im Empfang genommen und aufgrund des ausgesprochenen Hausverbots des SC Preußen mit einem Platzverweis für die Stadt Münster belegt. Weitere Teile der aktiven Fanszene erfuhren von den Maßnahmen des SC Preußen Münster und betraten aus Solidarität mit den ausgesperrten Fans das Stadion ebenfalls nicht. Trotz der durch den SC Preußen Münster hervorgerufenen Situation, der daraus resultierenden aufgeheizten Atmosphäre und einer entsprechend angespannten Sicherheitslage an den Eingängen zum Stadion kam es hier zu keinen weiteren Vorkommnissen. Die aktive Fanszene des TSV 1860 München fuhr daher bereits vor Beendigung des Spiels zurück nach München ohne das Spiel gesehen zu haben und ohne die Mannschaft in einem wichtigen und schweren Auswärtsspiel unterstützen zu können.
Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse empfinden wir die durch den SC Preußen Münster und die Polizei Münster ausgesprochenen Kollektivstrafen als überzogen und unnötig. Dies hat der Geschäftsführer des TSV 1860 München den Verantwortlichen vor Ort bereits in aller Deutlichkeit mitgeteilt. Nur durch die gute Zusammenarbeit der Fanbetreuung und der Abteilung Spielbetrieb/Sicherheit des TSV 1860 München mit den eigenen Fans und die besonnene Reaktion der aktiven Fanszene konnte eine mögliche Eskalation verhindert werden.
Preußen Münster widerspricht: Keine Kollektivstrafe gegen 1860-Ultras
Der TSV 1860 hat mit der Tonierung seiner Presseerklärung am Mittwochmorgen auf jeden Fall überrascht, als der Traditionsklub aus Giesing in Richtung Münster behauptete, “dass eine unverhältnismssige Kollektivstrafe” gegen die eigenen Fans ausgesprochen worden sei, die noch dazu “unnötig und überzogen” war. Tatsache ist, dass die Polizei 33 Löwen-Fans vorwirft, auf dem Pendlerparkplatz Werl-Süd Verkehrsschilder besprayt und beklebt zu haben. Die Polizei Soest nahmen die Personalien von 33 Tatverdächtigen auf. Der Vorwurf: Sachbeschädigung.
Obwohl dieser Gruppe kommuniziert wurde, dass sie nach diesem Vorfall nicht mehr ins Preußenstadion kommen werde, setzten die Löwen-Fans ungeniert ihre Fahrt Richtung Münster fort. Die “MünsterscheZeitung” schreibt dazu: “So erläutert Preußen Münster das Vorgehen, das laut Polizei keinesfalls außergewöhnlich ist, sondern eher die Regel, wenn bereits auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel eine Straftat begangen wird.”
Die Löwen hatten in ihrem Schreiben bemängelt, dass diese Entscheidung “ohne die normal übliche Rücksprache” mit Löwen-Vertretern geschehen sei. Laut dem Blatt sei das nach Spielbeginn übliche Kurvengespräch mit Sicherheitskräften und Vertretern bei der Vereine habe stattgefunden – allerdings ohne den TSV 1860. Die Gründe dafür seien unbekannt. Ob es zuvor eine Kontaktaufnahme mit den Löwen gegeben habe, ist unklar. An der Entscheidung hätte sie aber ohnehin nichts geändert. Kurios: In Münster waren 1860-Sicherheitschef Dominik Rassl und der Fanbeauftragte Felix Hiller eigentlich vor Ort.
Von einer Kollektivstrafe wolle Preußen Münster, wie die Löwen behaupteten, nichts wissen: Es gab “keinerlei Vorbehalte” gegen Fans außerhalb der in Werl aufgegriffenen Gruppe gegeben. Richtig ist, dass sich der Rest der Ultra-Szene mit der angezeigten 33-Mann-Crew solidarisierte und bereits kurz nach der Halbzeitpause die Heimreise angetreten hat. So verpassten die Anhänger das 1:1 ihrer Löwen gegen den guten Aufsteiger.
FANport-Newsletter #50
Eine runde Sache, so eine fünfzigste Ausgabe eines Newsletters. Den Schampus sparen wir uns aber angesichts der aktuellen Weltlage…
Dringende Empfehlung: Schaut einmal in das Programm der Fußballkulturtage NRW. Dort sind wir gleich mit zwei Veranstaltungen vertreten, die beide diese Woche stattfinden:
https://www.fanport-muenster.de/fussball-kulturtage-nrw/
Vielleicht sehen wir uns ja morgen bei der Lesung zu Erwin Kostedde? Ich würde mich freuen…
Herzliche Grüße
Edo Schmidt
FAZ: 60 Jahre Fußball-Bundesliga: Ossis gegen Wessis zum Jubiläum
(…) Auch in Rostock, wo im Umfeld rechtsextreme Akteure immer eine Rolle spielten, müsse „man lange suchen“, um auf Bannern aus der Kurve eine Botschaft zu finden, die „explizit rechtsextrem ist“, sagt Gabriel. So hänge das Banner ,Lichtenhagen’vom Fanklub seit 15 Jahren im Stadion, wurde dann aber gegen das „linke“ St. Pauli als Provokation an einer prominenten Stelle im Block aufgehängt. Ob reine Provokation oder vielleicht auch Zustimmung zu den tagelangen Angriffen auf ein Asylbewerberheim im Jahr 1992 werde dadurch offengelassen. „Ich bin nicht naiv, es gibt überall Konfliktlinien, die mit den gesellschaftspolitischen Entwicklungen stärker werden. In den Kurven sind auch weiterhin Rassisten, Rechtsextreme und Antisemiten unterwegs, aber ganz selten, wie zum Beispiel in Cottbus, haben sie die Oberhand. In der Regel liegt die Dominanz bei den anderen Gruppen, die eine demokratische und antirassistische Fankultur leben.“ Aus diesem Grund sieht Gabriel die Arbeit in den Fanprojekten als unverzichtbar an. (…)
Zum vollständigen Artikel: https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/bundesliga/60-jahre-fussball-bundesliga-ossis-gegen-wessis-zum-jubilaeum-19112658.html